
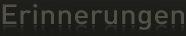
Es begann zu regnen und meine Strümpfe wurden schwarz gefleckt vom rußigen Asphalt. So zog ich die Strümpfe aus, ich fürchtete sie zu verderben, sie gehörten ja nicht mir. Aber, o Schreck, nun wurden meine Beine und Füße schmutzig. Ich hatte Sandalen an, wir nannten sie damals Christusschlapfen, da waren die Zehen frei – und ganz schwarzgefleckt, auch die Füße und Beine herauf. Zu allem Überfluß sagte dann auch mein Onkel: „Hast du denn kein schwarzes Kleid?“ Das Herz war mir schwer. Ich suchte die Eingangstüre zum Büro des Doktor Franz Berger. Das war eine lederne Türe mit Knöpfen. Mir war es, als müsste der liebe Gott dahinter wohnen. Nach zaghaftem Klopfen hörte ich eine freundliche, mir überaus lieblich vorkommende Stimme „Herein“ sagen. Ich stand einem gütigen Menschen gegenüber, der mich bat, Platz zu nehmen. Meine Sorge war es meine Füße zu verstecken, diese schwarzgesprenkelten Zehen und Beine. Das war leider nicht möglich. Ich saß auf einer kastenähnlichen Bank, das konnte ich nichts verbergen. So brachte ich denn mein Anliegen vor: Ich möchte Lehrerin werden und in der Freizeit und in den Ferien zeichnen und malen. Da zeigte mir Doktor Berger einen ganzen Stoß von Zeichnungen. Sie waren alle von mir. Durch Herrn Bernhard Ludwig waren sie bereits in seine Hände gelangt, ich war somit für den Landesschulinspektor keine Fremde mehr. Ein Stein fiel mir vom Herzen. Ich wusste, dass mir geholfen werden würde. Er meinte: „Liebes Kind, fahre nur ruhig nach Hause, du wirst von mir bald hören.“ So war ich nun wieder in Suben.
In jener Zeit zogen oft Zigeuner durch das Dorf. Die Leute liefen schnell zur aufgehängten frischen Wäsche, um sie vor Diebstahl zu schützen. Ich blieb am Straßenrand stehen und beobachtete die Zigeuner interessiert. Plötzlich lief eine junge Zigeunerin aus der Reihe auf mich zu und sagte: „Ich dir Hand lesen“ und schon hatte sie meine Hand gefasst und prophezeite mir: Du edlen Beruf ergreifen, du bald in eine schöne Stadt kommen.“ Eine Woche später bekam ich ein Telegramm, ich sollte sofort zur Aufnahmsprüfung in die Lehrerbildungsanstalt zu den Ursulinen nach Salzburg kommen. Ich machte die Prüfung für den zweiten Jahrgang und bin so nur vier Jahre in Salzburg geblieben. Meinen Eltern ging es dann finanziell schon etwas besser. Ich bekam 24S mit. 20S kostete das Zimmer, 3S wurden für die Bücher gerechnet, für mich blieb 1S. Ein Kilogramm Zwetschken kostete damals dreißig Groschen. Ich brauchte wenig, im Kloster bekam ich das Essen umsonst. Dort brauchte ich mich nur an eine Durchreiche, eine Art Guckerl zu stellen, da wurde mir eine Blechschüssel mit meinem Essen herausgeschoben. Das Essen war für meine Begriffe recht gut. Sonntags schickte mir Mater Stanisla (sie war eine vornehme, adelige Nonne und mir sehr zugetan) ihren Nachtisch. Ihr, glaube ich, war es mit zu verdanken, dass ich eine Freistelle erhalten hatte. Meine erste Federzeichnung war eine Krippendarstellung. Ich habe sie ihr gewidmet.
So gern ich nun zeichnete, so war mir der Zeichenunterricht durch die Zeichenlehrerin, selbst eine malende Nonne, verleidet. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich haßte. Oft habe ich, zum Gaudium meiner Mitschülerinnen, allerlei Tiere, Elefanten, Kühe oder Pferde in alle Eile an die Tafel gezeichnet. Dann kam meist ganz plötzlich die Zeichenlehrerin herein und rief in barschem Ton: „Auslöschen! Dorn!“ Sie mochte mich nicht. Unsere Zwiegespräche waren immer kurz. Einmal fragte sie mich: „Gehört um das Ölbild ein Rahmen?“ „Ja“ sagte ich, „Nein“ die Klosterschwester. „Setz dich!“
So war mir Deutsch zum liebsten Fach geworden. Wir hatten einen sehr gescheiten und lieben Professor – Dr. Hojer -, Mann der Schriftstellerin Rachmanowa (Milchfrau von Ottakring). Als ich zur Matura ging, meinte er: „Die philosophischen Themen übernimmt Fräulein Dorn.“ Ich war so aufgeregt, dass ich kaum befriedigende Antworten gab. Doch Dr. Hojer bestand darauf, mir in diesem Fach ein „Sehr gut“ zu geben. So maturierte ich also 1936 recht und schlecht. Dann ging es heim in die Ferien. Ich zeichnete jeden Tag und fühlte dennoch eine Leere in mir. Je mehr es dem Herbst zuging, desto unruhiger wurde ich. Ich wusste plötzlich, dass ich nicht Lehrerin sein konnte und sagte daher meinen Eltern, dass ich nach Wien gehen möchte. Meine liebe Mutter erschrak. Sie musste mir mitteilen, dass ich von daheim keine Unterstützung zu erwarten hätte. Ich suchte um ein Stipendium an. Ich bekam soviel, dass ich nach der Aufnahmeprüfung das Schulgeld für die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt bezahlen konnte; auch blieb einiges für mich übrig, aber was zum Leben notwendig war, musste ich sehr gut einteilen. Die erste Zeit wohnte ich bei Bekannten in der Münzwardeingasse, doch ging ich dort bald weg und nahm mir ein Zimmer. Den Aufenthalt in der „Graphischen“ hatte ich bald satt. Da wurde nur einmal in der Woche Porträt gezeichnet, das war mir zuwenig. Das Darstellen von Plakaten, Schriften, Reklame und dergleichen lag mir nicht. Ich möchte aber betonen, dass ich erkannte, wie ausgezeichnet diese Schule war.




So wagte ich den Schritt in die Kunstakademie am Schillerplatz in Wien. Ich frage den Portier, ob ich den „Direktor“ sprechen könne. „Ja, was wollen Sie denn von seiner Magnifizenz?“, antwortete er. Da kam es mir zu Bewusstsein, dass ich mich in einer wirklichen Hochschule befand. Neben mir stand ein Architekturstudent, der wies mich an einen Professor, der den ersten Jahrgang für Malerei leitete, Pofessor Larwin. Ihn bat ich, mich in seine Klasse aufzunehmen. Er bedauerte, er dürfte nicht mehr als vierzig Studenten annehmen, die Zahl sei überschritten und außerdem die Aufnahmeprüfung längst vorüber. Ich hatte eine Rolle mit Zeichnungen von Kinderköpfen bei mir, die ich hinter dem Rücken versteckt hielt. Nach diesem negativ verlaufenen Gespräch wollte ich sie nicht mehr herzeigen. Larwin war jedoch neugierig, zog die Rolle an sich, und fragte mich, ob ich diese Porträts selbst gezeichnet hätte. Als ich das bejahte, meinte er: „Kommen sie morgen zur Aufnahmsprüfung!“ Ich war hochbeglückt. Leider erhielt ich das Schulgeld, das ich der „Graphischen“ gezahlt hatte, nicht zurück, und so begann ich auch die Studentenzeit in großer Armut. Es war ja ganz allgemein eine sehr schlechte Zeit, so hatten auch die Studenten, mit geringen Ausnahmen, wenig zu beißen. Überdies kannte ich mich nicht aus. Ich wusste zum Beispiel lange nicht, dass es Eßkarten für die Mensa und für die Gaststätte im Messepalast gab. Einmal schrieb ich in meinem Tagebuch: „Ich habe solchen Hunger, dass ich die Sessellehne anbeißen könnte!“
